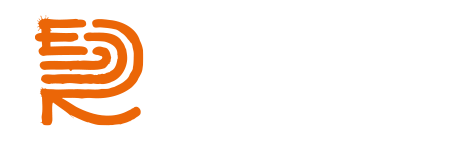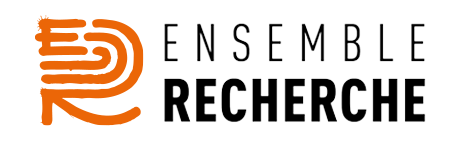How contemporary is music in the 21st century, if it continues to be so eurocentric? In a cooperation with the Goethe-Institut, the Ensemble Recherche invites ten composers and sound artists from developing countries and emerging economies to an artistic exchange. They will discuss (post-)colonialism and condense their knowledge into artistic results. At the end of the one year project period, there will be musical performances and hopefully some insight in our own patterns of evaluation. The South African composer Bongani Ndodana-Breen, fellow at Yale and Harvard Universities, accompanies the project as a curator and answered Friedemann Dupelius some questions.


Bongani Ndodana-Breen: In meinem Umfeld gab es viel afrikanische Musik auf Feiern und bei häuslichen Zusammenkünften. Die meisten afrikanischen Komponist*innen lernen klassische Musik in der Schule und durch die Kirche kennen. Zudem spielte meine Großtante Klavier und auch ich erhielt Klavierunterricht als Kind. Es macht eine kolonialisierte Kultur aus, dass da diese zwei Kulturen nebeneinander existieren. Insbesondere die kolonisierten Menschen müssen ihren Weg zwischen der Kultur und Sprache der Kolonialmacht und ihrer eigenen Kultur finden. Die Siedler*innen müssen das nicht, sie betreiben ihre Kultur und ihre Institutionen einfach weiter.
Wie kann man sich die Szene für zeitgenössische Musik in Südafrika vorstellen? Wie divers ist sie?
Sie ist sehr klein und beschränkt sich hauptsächlich auf die Universitäten und ein paar kleine Gruppen. Es ist sehr selten, dass unsere Symphonieorchester neue Werke aufführen. Die meisten südafrikanischen Komponist*innen arbeiten hauptsächlich im Ausland. Ich bin der erste und bislang einzige schwarze Komponist, der in die Abokonzertreihe des Cape Town Philharmonic Orchestra aufgenommen wurde. Als ich darauf hinwies, dass wir mehr Vielfalt und Inklusion brauchen, habe ich Probleme bekommen. Ich denke, die von Weißen geleiteten Institutionen haben auf gewisse Art und Weise Angst vor ihrem Publikum. Es muss noch viel getan werden, um die Akzeptanz zeitgenössischer Musik in Afrika zu fördern.
Was können wir Europäer*innen von Komponist*innen aus anderen Regionen des Globus lernen?
Nehmen wir zum Beispiel Afrika: Dort hat Musik traditionell einen sozialen Kontext. Sie ist partizipativ und bringt eine Gemeinschaft zusammen. Zweitens gibt es in afrikanischer Musik das Element der Bewegung. Musik im Westen ist sehr passiv. Ich habe nie verstanden, wie Menschen Musik ohne körperliche Reaktionen erleben können. Selbst in meinen Stücken gibt es gewisse tänzerische Elemente. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Gehirn afrikanisch gepolt ist. Und drittens hat Europa eine sehr abstrahierte Musik entwickelt, Afrika nicht. Ich denke, der Westen kann viel lernen.
Die Demographie verändert sich, das Publikum wird älter und Musik hat viel Konkurrenz bekommen, zum Beispiel geben Leute Geld für Dinge wie Games aus. Da können Konzepte wie die in Afrika, etwa Partizipation oder der Einbezug von Bewegung, sehr hilfreich sein. Europa war so dominant in der klassischen Musik und hat alle anderen Stimmen ausgeschlossen, sodass ich hoffe, dass dieses Projekt da ein paar Dinge gerade rücken kann.
Nach welchen Kriterien werden die Teilnehmer*innen für den Workshop ausgewählt?
Ich werde besonders auf weibliche Komponist*innen achten, sie wurden so oft ausgeschlossen. Geschlechterdiversität ist mir sehr wichtig. Der akademische Hintergrund der Teilnehmer*innen wird kein Kriterium sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, seine Kunst zu verfeinern – ein Hochschulstudium kann natürlich eine davon sein, doch hier in Afrika haben wir eine mündliche Kultur, in der Informationen von der einen zur anderen Generation weiterge- geben werden, auch in der Musik. Ich glaube, dass diese indigenen Wissenssysteme einen ernstzunehmenden Lernprozess ermöglichen und nicht ignoriert werden sollten.